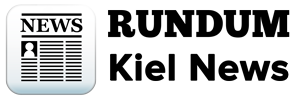Diversität ist ein sperriges Wort. Tyron Ricketts weiß aber genau, was es meint. Und der Musiker, Produzent und Schauspieler («Russendisko», «Dogs of Berlin») weiß aus eigener Erfahrung auch, dass es daran in deutschen Filmen noch immer fehlt.
Ricketts (45), Sohn einer Österreicherin und eines Jamaikaners, hat seit einem Vierteljahrhundert in mehr als 60 Filmen mitgespielt. Mal als der farbige Polizist, mal als der gut gelaunte Hoteldirektor auf Mauritius, wie Ricketts bei der Media Convention Berlin (MCB, noch bis 8. Mai) erzählt. Aber nie als ein Mensch wie er selbst, «in 95 Prozent war ich immer der andere». Wenn er für eine Rolle besetzt wurde, dann oft voll nach Stereotyp und entgegen der Wirklichkeit der deutschen Gesellschaft im 21. Jahrhundert.
«Ich spiele gern einen Gangster, aber ich spiele auch gerne mal einen Anwalt – solange sich das die Waage hält.» Noch ist die Branche nicht da, wo sie in Sachen Diversität sein könnte, findet er. «Wir haben ein sehr eurozentrisches Weltbild, bei dem oft ein weißer Mann im Mittelpunkt steht. Und das hat auch Auswirkungen auf Film und Fernsehen gehabt.»
Das sieht der Casting Director Emrah Ertem ähnlich: «Es ist traurig, dass Diversität noch immer so behandelt wird, als ob es etwas völlig Neues wäre», sagte Ertem. «Warum kann Tyron Ricketts nicht einen Deutschen spielen?» Eine Bewegung in die richtige Richtung sei zum Beispiel bei ARD und ZDF durchaus zu erkennen – bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gebe es eine immer größere Selbstverständlichkeit, Rollen divers zu besetzen.
Das hat auch Martina Zöllner beobachtet, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) für den Programmbereich Doku und Fiktion verantwortlich. Das absehbare Ende des klassischen, linearen Fernsehens bringe auch bessere Möglichkeiten für mehr Diversität mit sich, sagt sie. Die Formate, die bisher zum Beispiel um 20.15 Uhr gezeigt werden und dann eine Standardlänge wie 45 oder 90 Minuten haben müssten, gebe es beim «Fernsehen on demand» nicht mehr in dieser Form. «Das ermöglicht auch ein neues Erzählen.» Und beim Thema Geschlechtergerechtigkeit habe sich in der Branche ohnehin schon viel getan – vor und hinter der Kamera.
Diversität breiter zu fassen und nicht auf den Mann-Frau-Aspekt zu verengen – daran liegt Skadi Loist viel. Sie ist Gastprofessorin an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und verweist auf das Beispiel Großbritannien. Dort gibt es bereits seit 2016 «Diversity Standards», Regeln, die zum Beispiel bei der Filmförderung gelten und bei denen Diversitätsaspekte wie Alter, Religion, sexuelle Orientierung oder regionale Teilhabe berücksichtigt werden. Regionale Teilhabe? Soll heißen: Genauso wenig, wie immer nur weiße Heterosexuelle durch den Film flirten müssen, sollten auch Menschen aus Leeds oder Liverpool mal die Hauptrolle spielen – nicht immer nur Londoner.
Diversität heißt eben viel mehr: zum Beispiel, dass in Filmen auch alte, kranke Menschen zu sehen sind oder einkommensschwache – und nicht immer nur mittelalte, gut aussehende Mittelschichtler. Oder dass auch unterschiedliche Religionen gezeigt werden, Zeugen Jehovas genauso wie Hinduisten, schwule Hausmeister genauso selbstverständlich wie Transmenschen in Führungspositionen oder lesbische Lastwagenfahrerinnen.
Dass sich die Medienbranche in Richtung Diversität entwickelt, davon ist Martina Zöllner überzeugt: «Unsere Gesellschaft wird diverser», sagt sie – und das habe auch Auswirkungen auf Film und Fernsehen. Tyron Ricketts, der bei seiner eigenen Produktionsfirma Panthertainment Diversität groß schreibt, würde sich das nur das wünschen – weil er an den gleichen Effekt glaubt, nur andersherum: «Mehr Diversität im Film hat auch Einfluss auf die Gesellschaft», sagt er. «Bevor Obama Präsident wurde, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das möglich ist.» Die Macht der Bilder gelte aber auch fürs Fernsehen. Wenn Ricketts recht hat, könnte es tatsächlich nicht nur in der Medienwelt ein Fortschritt sein, wenn Menschen mit dunkler Hautfarbe öfter mal den Anwalt und seltener den Gangster spielen.