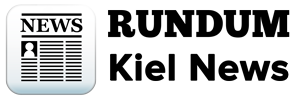Devid Striesow betritt die Bühne des Hamburger Schauspielhauses. Ein Stuhl, ein Tisch, eine Lampe. Striesow lächelt, sagt „Hallo“ , setzt sich und trägt Texte von Robert Walser vor. Komische, verschrobene, sprachgewaltige Preziosen. Den meisten Applaus gibt es nach einem Text mit dem Titel „Nervös“. Ein Mann rechtfertigt sich darin für seine Nervosität. Und das tut er äußerst nervös.
Man hat das Gefühl, dass Striesow über sich selbst spricht. Mann und Text werden eins: „Aber nervös bin ich ein wenig, zweifellos bin ich das ein wenig, sehr wahrscheinlich bin ich das ein wenig, möglicherweise bin ich das ein wenig. Ich hoffe, dass ich ein wenig nervös bin. Nein, ich hoffe es nicht, so etwas hofft man nicht, aber ich fürchte es, ja, ich fürchte es.“
Am nächsten Morgen treffen wir Devid Striesow in seinem Hotel zum Interview. Ein freundlicher, zugewandter, mittelgroßer Mann. Ganz gut in Form. Striesow trainiert regelmäßig an Geräten. Er setzt sich und lächelt. Dieses Lächeln kann alles bedeuten: Spott, Freude, Zustimmung, Distanziertheit, Verweigerung. Striesow kann einen in Grund und Boden lächeln.
Devid Striesow spielt Martin Luther
Bald ist der Schauspieler im Fernsehen als Martin Luther zu erleben. Wie ein deutscher Depardieu predigt, schimpft und kämpft sich Striesow wuchtig und körperbetont durch den ARD-Film „Katharina Luther“ (Mittwoch, 22. Februar, 20.15 Uhr, ARD). Ein zerrissener Mann, der gegen den Papst, den Teufel und immer auch gegen sich selbst gekämpft hat. Ein hochenergetisches Genie.
Die Bezeichnung passt auch zu Striesow. 2006 bekam er die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Darüber öffentlich reden will er heute nicht mehr. Aber der Begriff steht im Raum. Devid Striesow ist ein äußerst lebhafter Gesprächspartner. Immer wieder springt er auf, gestikuliert, erklärt Gesagtes mit dem ganzen Körper. Wenn er über das Degenfechten auf der Bühne spricht, muss er einfach aufstehen und einem fiktiven Gegner zeigen, dass er schneller ist. Schauspieler, das betont er immer wieder, sei der ideale Beruf für ihn. Da kann er sich austoben, auspowern, einbringen.
Striesow in einem Bürojob? Unmöglich! Spontan imitiert er den Sachbearbeiter einer Versicherung, wühlt murmelnd und fahrig in fiktiven Dokumenten, findet nichts, verliert dekorativ die Fassung. Nein, dieser Mann bei der Volksfürsorge – das ginge nicht.
1_Katharina_LutherHerr Striesow, Sie kommen aus einem atheistischen Elternhaus. Was hat Sie daran interessiert, Martin Luther zu spielen?
Sein bipolarer Charakter. Luther war eine manisch-depressive Persönlichkeit. Der lebte viele Jahre in einer komplett verwahrlosten Klosteranlage in Wittenberg. Dort hauste er wie ein Messie zwischen all seinen Büchern und Schriften. Luther war zu diesem Zeitpunkt schon berühmt, der große Reformator der Kirche, ein Popstar seiner Zeit. Er war aber auch ein zerrissener Mensch, dessen Leben erst durch seine Frau Katharina eine äußere Ordnung bekam.
War Luthers manisches Wesen eine Voraussetzung für seinen enormen Schaffensdrang?
Ganz sicher. Seine hohe Energie versetzte ihn erst in die Lage, so ungeheuer produktiv zu sein. Luther arbeitete oft so lange an seinen Schriften, bis er in seiner Kammer vor Erschöpfung zusammenbrach.
Was trieb Luther derart voran?
Für ihn ging es immer auch um Leben und Tod. Die Figur des Teufels war ihm eine real existierende Bedrohung. Eine lauernde Macht, die einen beständigen Schatten auf sein Leben warf. Das musste ich auch erst einmal kapieren. Wenn man wie ich als Kind nicht lernt, was mit Glauben gemeint ist, kann man das später nicht mehr aufholen.
Sie wuchsen als Sohn eines Elektrikers und einer Kinderkrankenschwester in Rostock auf. Warum lehnten Ihre Eltern die Kirche ab?
Das waren gar nicht nur meine Eltern, das war eigentlich die ganze Gesellschaft in der DDR. Die Kirche galt als rückständig. Sie existierte, wurde aber ausgeblendet. In meiner Klasse waren nur zwei Mitschüler, die in der evangelischen Kirche waren. Die anderen, so wie ich auch, waren alle bei der FDJ.
Empfinden Sie die Abwesenheit des Glaubens in Ihrer Jugend heute als Mangel?
Ach, nee, so war das eben. Heute würde ich mich aber schon als einen spirituellen Menschen bezeichnen.
Was bedeutet das?
Ich glaube, dass es eine höhere Energie gibt, die nicht sichtbar ist und die Dinge lenkt. Weihnachten war ich in einer katholischen englischsprachigen Messe. Das war sehr schön. Ich mag die Rituale, die Atmosphäre, aber ich bleibe doch immer nur ein Besucher. Ich sympathisiere mehr mit dem Buddhismus als mit dem Christentum, weil ich das Gefühl habe, dort wird weniger ausgegrenzt.
Sie sind ein Buddhist mit christlichem Überbau …
Ja, so in etwa, wie es Hape Kerkeling mal von sich gesagt hat.
Schon bevor Sie Hape Kerkeling in seiner Bestsellerverfilmung „Ich bin dann mal weg“ spielten, waren Sie von seinem Sinnsucher-Pilgerbuch angerührt. Warum?
Ich habe da eine Verbindung gespürt, eine ähnliche Blutgruppe. Hape ist ein hochenergetischer Typ. So wie ich das auch bin. Hape war erst 28, als er „Kein Pardon“ gemacht hat. Eine wahnsinnig gute Komödie!
Sie drehen oft auch wie ein Besessener einen Film nach dem anderem …
Ach, nee, stimmt so gar nicht mehr. Ich habe jetzt drei Monate gar nichts gemacht. Neulich wurde mir mein Handy geklaut. Seit acht Wochen schon habe ich kein eigenes mehr.
Und macht Sie das nervös?
Nein, überhaupt nicht, weil ich es hasse zu telefonieren. Darum verschiebe ich es immer wieder, mir ein neues zu kaufen.
So entspannt schienen Sie aber nicht immer. Es gab Jahre, da drehten Sie zwölf Filme hintereinander.
Das waren einfach tolle Projekte! Und wir haben 2008 für „Die Fälscher“ sogar den Oscar nach Hause getragen. Manchmal waren es auch zwei Filme gleichzeitig. Den einen habe ich nachts in Hamburg gedreht, den anderen tagsüber am nächsten Tag in Potsdam.
Klingt anstrengend.
Nein, es ist ein riesiger Spaß. Es gibt Kollegen, die sagen: Schauspiel muss eine Tortur sein. Drehen ist wie Krieg. Alles Unsinn! Es ist Lebenszeit, und die muss Spaß machen. Du weinst, du schreist, du flippst, du brichst zusammen vor der Kamera, aber du musst immer Spaß daran haben. Alles andere ist Psychotherapie, weg damit. Das können die Leute ihrem Analytiker erzählen.
Wann entdeckten Sie den Spaß am Spiel?
Recht spät. Schauspielerei hat mich lange nicht interessiert. Ich wollte Musiker werden, als ich jung war. Meine erste Gruppe war eine Singegruppe der Dieselmotorenwerke in Rostock. Später hatte ich meine eigene Band. Wir machten auf Pogues, Punk, gemischt mit irischem Folk.
Wie gut waren Sie?
Ach Gott, ich bin froh, damit nicht weitergemacht zu haben. Ich hätte im Musikstudium meinen Ansprüchen ganz sicher nicht genügt. Klavier von der Partitur zu spielen – das war mir einfach zu hoch. Das mit dem konsequenten und manchmal eben stupiden Üben war nicht so meine Sache.
Wie kamen Sie zum Schauspiel?
Ich wollte nach dem Zivildienst in Rostock nach Berlin, um die Großstadt zu erkunden. Damals sah ich Klaus Maria Brandauer als Mephisto. Das hat mir die Augen geöffnet. Wie der spielte! Und dazu diese Welt. Die Bühne, das Verruchte, die Scheinwerfer. Das hat mich angezogen.
Sie landeten auf der renommierten Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Dort sagte man Ihnen: „Striesow, den Hamlet wirst du niemals spielen! Such dir mal eine volkstümliche Ecke.“ Eine Kränkung?
Das war eine klare Ansage. Die haben mir nichts vom Pferd erzählt. Der Hamlet war dann später gleich die zweite große Rolle am Theater.
Gab es nie Momente des Selbstzweifels?
Doch, natürlich. Schauspiel hat für mich etwas sehr Kindliches. Du lässt dich wie ein Kind in eine Sandkiste fallen und erschaffst dir eine eigene Realität. Ich wollte auf die Bühne, herumspielen – und dachte, damit ist der Job erledigt. War natürlich nicht so. Die wollten mich ausbilden, worauf ich erst mal keinen Bock hatte.
Sie wollten alles hinwerfen?
Ich bin nach Rostock zurückgefahren. Wollte wieder mit meiner alten Band spielen. Der Schauspieler Thomas Thieme hat mir den Beruf zum Glück aus einer anderen, seiner praktischen Perspektive gezeigt.
Wie groß war damals Ihr Ehrgeiz?
Ich war wie ein junger Hund, der an der Tür scharrt und nach draußen will. Das Leben wartet, und ich wollte als Schauspieler alles bedienen.
Anthony Hopkins soll einmal gesagt haben: Schauspieler müssen nur zwei Dinge können – den Text und pünktlich sein.
Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, und beides gelingt jedem nur mäßig. Hopkins ist natürlich ein ganz Großer. Als Hannibal Lecter steht der wortlos in einem Glaskasten, und nur von seinem Blick bekommt man eine Todesangst. Das musst du erst mal hinbekommen.
Sie haben gesagt, der Beruf des Schauspielers sei Ihre Rettung gewesen. Warum?
Ich bin intuitiv in diesem Beruf gelandet. Devid Striesow als Bibliothekar oder bei einer Versicherung – das hätte nicht funktioniert.
Wieso nicht?
Als ich jung war, bin ich in den Probepausen immer herumgesprungen. Bam, bam, bam. Die anderen haben gesagt: „Devid, komm doch mal runter. Was ist denn los?“ Dann habe ich gesagt: „Kommt ihr doch erst mal rauf!“ Ich wollte die Spannung halten.
Sie wirken wie jemand, der stark unter Strom steht. Wie oft gehen Ihnen die Dinge nicht schnell genug?
Das war früher schwieriger. Da musste ich aufpassen, dass ich mein Gegenüber nicht immer unterbreche, weil ich gedanklich schon eine Ecke weiter war.
2013 wollte Sie Woody Allen für seinen Film „Magic in the Moonlight“ engagieren …
… und mir wurde ausgerichtet, dass er sich alle meine Kinofilme zur Vorbereitung angeschaut hatte. Wow, dachte ich, was für eine Vorstellung! Der große Woody Allen sitzt im Wohnzimmer und schaut dir beim Spielen zu. Mehr geht nicht. Leider hatte ich keine Zeit und musste ihm absagen.
Jeder andere Schauspieler würde sich ein Bein ausreißen, um mit Woody Allen zu drehen.
Ach, klar wäre das wahnsinnig toll gewesen, aber das Leben geht weiter. Ratz, batz, weg geht die Welle.
Ihr ältester Sohn Ludwig arbeitet inzwischen selbst als Schauspieler.
Und das macht er sehr gut. Ich schaue ihm gern zu. Er ordnet das Spiel auch ganz klar dem Spaß unter. So wie ich.
Den Spaß verbinden Sie nicht selten mit extremem Ehrgeiz. 2009 nahmen Sie für eine Rolle 23 Kilo innerhalb von sieben Wochen ab.
Ich wog damals 90 Kilo und sah beschissen aus. Dünne Arme und Beine, vorn so eine Wampe. Der Regisseur Tom Tykwer engagierte einen Fitnesstrainer. Bei unserem ersten Treffen sagte der: Damit dieses Trainingsprogramm Erfolg hat, braucht man einen, der bereit ist, seinen Kopf leer zu schalten.
Wie schwer war es?
Das war nur hart, nur Mist, aber das Ergebnis war geil. Die organisierten mir irgendwann einen Fahrer, weil ich so ausgelaugt war und mit meinem Bus gegen einen Pfahl fuhr, weil ich nicht mehr klar denken konnte. Schwimmen, Krafttraining, Judo-Unterricht, keine Kohlenhydrate mehr, da wirst du plemplem im Kopf. Am Ende waren 23 Kilo weg, und ich hatte vier Kilo Muskelmasse dazugewonnen.
Was ist davon geblieben?
Einen Trainer habe ich immer noch. Und mit dem Sport habe ich seitdem nicht mehr aufgehört, aber ich bin gelassener geworden. Wenn ich mal einen Rotwein trinke, trainiere ich zwei Tage nicht. Heute höre ich mehr auf meinen Körper. Ich meditiere und praktiziere Yoga, so regelmäßig, wie es mir möglich ist. Das vermisse ich wirklich sehr, wenn es aus Zeitgründen nicht stattfinden kann.
Sie sind jetzt 43 und haben bereits in mehr als 120 Filmen mitgespielt. Sie haben viele Preise gewonnen. Hat der Erfolg Sie entspannter gemacht?
Nein, weil Erfolg keine dauerhafte Sicherheit und Zufriedenheit bringt. Ich brauche die Energie, das Spiel, die Anerkennung des Publikums, aber bitte nicht die Berieselung, den Stillstand, das Angekommensein. Alles muss immer gehen.
Die ARD zeigt „Katharina Luther“ am 22. Februar um 20.15 Uhr.
GoT Outtakes 17.00